Inhaltsverzeichnis
- 1 Gliederung und Aufbau der Bachelorarbeit „einfach erklärt“
- 2 Definition: Gliederung und Aufbau der Bachelorarbeit
- 3 Gliederung und Aufbau einer Bachelorarbeit
- 4 Vorlaufseiten der Gliederung und Aufbau einer Bachelorarbeit
- 5 Textteil der Gliederung und Aufbau einer Bachelorarbeit
- 6 Abschließende Bestandteile
- 7 Ergänzende Bestandteile
- 8 Formale Anforderungen der Gliederung und Aufbau der Bachelorarbeit
- 9 Beispiel Gliederung und Aufbau einer Bachelorarbeit
- 10 Häufig gestellte Fragen
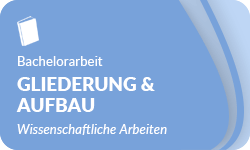
Insbesondere längere wissenschaftliche Arbeiten, wie die Bachelorarbeit, erfordern systematisch und nach einem Plan vorzugehen. Wie genau solche Arbeiten aufgebaut werden sollen, kann aber zur Verwirrung führen. Deswegen findest du hier wichtige Informationen zur Gliederung und Aufbau einer Bachelorarbeit, Schritt-für-Schritt und eine übersichtliche Erklärung, was bei jedem dieser Abschnitte zu tun und zu schreiben ist und wie.
Definition: Gliederung und Aufbau der Bachelorarbeit
Die Gliederung und Aufbau einer Bachelorarbeit sind strukturierte Rahmen, die die wichtigsten Inhalte und die Argumentationsweise der Arbeit organisieren und präsentieren. Die Gliederung und Aufbau einer Bachelorarbeit bestehen typischerweise aus einer Einleitung, in der das Thema, die Zielsetzung der Bachelorarbeit und die relevanten Forschungsfragen vorgestellt werden, einem Hauptteil, der die Untersuchung, Analyse und Diskussion der Forschungsthemen oder -fragen umfasst, und einem Schluss, in dem die Ergebnisse zusammengefasst, bewertet und in einen breiteren Kontext gestellt werden.
Diese Struktur hilft nicht nur bei der logischen und nachvollziehbaren Darstellung der Ergebnisse, sondern auch bei der Führung des Lesers durch die verschiedenen Aspekte und Stufen der Argumentation und Forschung. Ein gut durchdachte, klare Gliederung und Aufbau der Bachelorarbeit sind entscheidend für die Qualität, da sie die Kohärenz, Verständlichkeit und wissenschaftliche Strenge der Arbeit wesentlich unterstützen.
Gliederung und Aufbau einer Bachelorarbeit
Die Gliederung und Aufbau einer Bachelorarbeit folgen einer strukturierten, systematischen Aufteilung, die es ermöglicht, ein Forschungsthema umfassend zu behandeln und die Ergebnisse klar darzustellen. Folgende Bestandteile gehören in eine Bachelorarbeit:
- Vorlaufseiten
-
Textteil
- Einleitung
- Theoretischer Rahmen / Literaturüberblick
- Methodik
- Ergebnisse
- Diskussion
- Fazit
- Abschließende Bestandteile
-
Ergänzende Bestandteile
- Anhänge
- Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Glossar (falls erforderlich)
Im Folgenden gehen wir jede dieser Bestandteile durch und erklären dir Schritt-für-Schritt, deren erforderliche Inhalte sowie die Gliederung und Aufbau von Bachelorarbeiten im Ganzen.
Bevor du deine Bachelorarbeit tatsächlich schreibst, empfiehlt sich allerdings ein Exposé zu verfassen, welches als Vorbereitung gilt und in welchem du bereits die vorläufige Gliederung und Aufbau deiner Bachelorarbeit festlegst. Ein Exposé kann helfen, einen roten Faden in der Arbeit zu erhalten. Informationen zum Exposé der Bachelorarbeit findest du hier:
Vorlaufseiten der Gliederung und Aufbau einer Bachelorarbeit
Bevor der Textteil überhaupt beginnt, muss als erster Schritt in der Gliederung und Aufbau deiner Bachelorarbeit ein Deckblatt erstellt werden. Zusätzlich dazu müssen eine eidesstattliche Erklärung, Abstract und Inhaltsverzeichnis eingefügt werden und wenn du möchtest, auch eine Danksagung.
Das Deckblatt
Das Deckblatt der Bachelorarbeit ist das erste Element der Gliederung und Aufbau einer Bachelorarbeit und hat die Funktion, alle wesentlichen Informationen auf einen Blick zu präsentieren. Die spezifischen Anforderungen an das Deckblatt können je nach Universität variieren, typische Anforderungen an ein Deckblatt umfassen aber:
- Titel der Arbeit: Klare und präzise Formulierung des Themas.
- Name des Verfassers/der Verfasserin: Vollständiger Name des Studierenden, der die Arbeit verfasst hat.
- Matrikelnummer: Zur eindeutigen Identifikation des Studierenden.
- Studiengang: In welchem Studiengang die Arbeit verfasst wird.
- Betreuer/in: Name des/der betreuenden Dozenten/in oder Professors/in.
- Einreichungsdatum: Das Datum, an dem die Arbeit eingereicht wird.
- Name der Universität und Fakultät: Offizieller Name der Bildungseinrichtung und der zugehörigen Fakultät oder des Fachbereichs.
- Logo der Universität/Fachhochschule: Falls vorgeschrieben oder üblich.
Für genauere Informationen zum Deckblatt der Gliederung und Aufbau deiner Bachelorarbeit findest du hier mehr:
Die Danksagung
Die Danksagung ist ein optionaler Abschnitt in der Gliederung und Aufbau einer Bachelorarbeit, in dem der Verfasser oder die Verfasserin persönlichen Dank gegenüber Personen ausspricht, die während der Erstellung der Arbeit Unterstützung und Hilfe geleistet haben. Obwohl dieser Abschnitt persönlich und weniger formell ist, gibt es einige Punkte, die beachtet werden sollten:
- Positionierung: Meist folgt die Danksagung nach dem Deckblatt und vor oder nach der eidesstattlichen Erklärung in der Gliederung und Aufbau einer Bachelorarbeit.
- Ton: Persönlicher, aber respektvoll und professionell
-
Dank gilt üblicherweise:
- Betreuenden Dozenten für fachliche Unterstützung und Beratung.
- Institutionen oder Unternehmen, die bei der Forschung unterstützt haben, z. B. durch Bereitstellung von Daten oder Finanzierung.
- Familie, Freunden oder anderen Personen für persönliche Unterstützung, Motivation oder praktische Hilfe.
- Die Danksagung sollte nicht zu lang sein
Die eidesstattliche Erklärung
Die eidesstattliche Erklärung ist ein wesentlicher Bestandteil in der Gliederung und Aufbau der Bachelorarbeit und dient der Versicherung, dass die Arbeit selbstständig verfasst und alle verwendeten Quellen und Hilfsmittel korrekt angegeben wurden. Die genauen Anforderungen können je nach Hochschule variieren, aber üblicherweise beinhaltet sie Folgendes:
- Positionierung: Meist am Anfang der Arbeit, nach der Danksagung und vor dem Inhaltsverzeichnis in der Gliederung und Aufbau deiner Bachelorarbeit.
- Inhalt: Die Erklärung, dass die Arbeit selbstständig verfasst wurde, keine anderen als die genannten Quellen und Hilfsmittel benutzt und alle wörtlich oder sinngemäß übernommenen Inhalte als solche gekennzeichnet wurden.
- Persönliche Daten: Vollständiger Name des Verfassers/der Verfasserin und eventuell Matrikelnummer.
- Datum und Ort: Zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Arbeit.
- Unterschrift: Eigenhändige Unterschrift des Verfassers/der Verfasserin.
Mehr dazu und Formulierungsbeispiele findest du hier:
Das Abstract
Das Abstract in der Gliederung und Aufbau einer Bachelorarbeit soll eine Zusammenfassung der gesamten Arbeit darstellen, welches einen schnellen Überblick ermöglicht. Beachte, dass es das Erste ist, dass die Leserschaft von dir vorgestellt bekommt, somit ist dieser Eindruck essenziell. Folgendes solltest du inkludieren:
- Positionierung: In der Regel direkt nach dem Deckblatt oder der eidesstattlichen Erklärung, vor dem Inhaltsverzeichnis in der Gliederung und Aufbau der Bachelorarbeit.
- Länge: Meist zwischen 150 und 250 Wörtern, abhängig von den Vorgaben der Hochschule.
-
Inhalt:
- Hintergrund und Ziel der Arbeit: Kurze Vorstellung des Forschungsthemas und der zentralen Fragestellung(en) oder Hypothese(n).
- Methodik: Kurzer Überblick darüber, wie die Forschung durchgeführt wurde, einschließlich der verwendeten Methoden und Ansätze.
- Wesentliche Ergebnisse: Kurze Darstellung der wichtigsten Forschungsergebnisse.
- Schlussfolgerungen: Kurze Zusammenfassung der abgeleiteten Schlussfolgerungen und Implikationen der Arbeit.
-
Stil und Sprache:
- Klar, präzise und frei von Fachjargon, um auch Lesern ohne spezielle Vorkenntnisse das Verständnis zu ermöglichen.
- Sollte selbstständig verständlich sein, auch ohne den Rest der Arbeit gelesen zu haben.
- Schlüsselwörter: Manchmal werden einige relevante Schlüsselwörter angegeben, die den inhaltlichen Fokus der Arbeit widerspiegeln.
Das Inhaltsverzeichnis
Das Inhaltsverzeichnis spiegelt deine Gliederung und Aufbau der Bachelorarbeit wider und dient der Übersichtlichkeit und Strukturierung der Arbeit. Sie hilft Lesern, sich schnell zu orientieren. Hier sind die wichtigsten Anforderungen und Merkmale:
- Positionierung: Direkt nach dem Abstract, der Danksagung oder der eidesstattlichen Erklärung in der Gliederung und Aufbau einer Bachelorarbeit.
-
Inhalt: Auflistung aller geplanten Kapitel und Unterkapitel mit Seitenangaben.
- Titel und Untertitel der Kapitel und Unterkapitel, so wie sie im Text der Arbeit erscheinen.
- Seitenzahlen, auf denen jedes Kapitel bzw. Unterkapitel beginnt.
-
Struktur:
- Klare und logische Gliederung, zumeist nummeriert (z. B. 1, 1.1, 1.1.1 usw.).
-
Weitere Elemente:
- Listen wie Abbildungsverzeichnis, Tabellenverzeichnis, Abkürzungsverzeichnis etc. können ebenfalls aufgeführt sein.
- Einbeziehung des Literaturverzeichnisses, Anhangs etc. am Ende des Inhaltsverzeichnisses.
- Formatierung: Konsistent mit dem Rest der Arbeit (gleiche Schriftart und -größe, einheitliche Formatierung).
Das Inhaltsverzeichnis, der Gliederung und Aufbau deiner Bachelorarbeit muss fehlerfrei sein. Außerdem gibt es klare Regeln zu Struktur, die zu befolgen sind. Siehe dir aus diesem Grund definitiv nochmals den Beitrag hierzu an.
Textteil der Gliederung und Aufbau einer Bachelorarbeit
Jetzt kommt erst der eigentliche Textteil in der Gliederung und Aufbau deiner Bachelorarbeit, grob bestehend aus Einleitung, Hauptteil und Schluss. Der Hauptteil wiederum ist ebenfalls unterteilt. Hier findest du alle notwendigen Informationen dazu.
Die Einleitung
Die Einleitung bei der Gliederung und Aufbau einer Bachelorarbeit spielt eine entscheidende Rolle, da sie den ersten inhaltlichen Eindruck der Arbeit vermittelt und das Interesse der Leserschaft wecken soll.
Die folgenden Punkte sind für eine effektive Einleitung relevant:
- Positionierung: Direkt nach dem Inhaltsverzeichnis als Beginn des Haupttextes in der Gliederung und Aufbau einer Bachelorarbeit.
-
Inhalt:
-
Einführung ins Thema:
- Vorstellung des Untersuchungsgegenstands und des Kontextes der Arbeit.
- Aufzeigen der Relevanz und Aktualität des Themas.
-
Forschungsfrage und -ziele:
- Klare Formulierung der zentralen Forschungsfrage(n) oder Hypothese(n).
- Darstellung der Ziele der Arbeit.
-
Überblick über den logischen Aufbau:
- Kurze Beschreibung der Struktur der Arbeit: Was wird, in welchem Kapitel behandelt?
-
Einführung ins Thema:
- Länge und Umfang: Die Einleitung umfasst üblicherweise zwischen 5 % und 10 % der Gesamtlänge der Arbeit.
Die Einleitung sollte deine Leserschaft fesseln und sie dazu bringen deine ganze Arbeit lesen zu wollen, darum lies dir nochmals genauer durch, wie du sie am elegantesten formulieren kannst:
Der theoretische Rahmen
Der theoretische Rahmen (oder theoretische Grundlagen) in einer Bachelorarbeit dient dazu, die theoretische Basis und die relevanten Konzepte der Arbeit darzulegen. Dies tust du, indem du Literatur zum Thema liest und diese auch im Text zitierst. Hier sind einige wesentliche Aspekte:
- Positionierung: Folgt in der Regel direkt nach der Einleitung in der Gliederung und Aufbau deiner Bachelorarbeit.
-
Inhalt:
- Definitionen und Erklärungen der zentralen Begriffe und Theorien: Klärung und Abgrenzung der Schlüsselbegriffe, die in der Arbeit verwendet werden.
- Relevante Theorien und Modelle: Vorstellung und Diskussion der Theorien und Modelle, die für das Verständnis und die Analyse des Forschungsgegenstands notwendig sind.
- Forschungsstand: Aufarbeitung des aktuellen Forschungsstands im Themenbereich, um die Einbettung der eigenen Forschung in das wissenschaftliche Umfeld zu zeigen.
-
Ziele:
- Schaffung eines soliden theoretischen Fundaments für die Untersuchung.
- Verdeutlichung, wie die Arbeit in den aktuellen wissenschaftlichen Diskurs einzuordnen ist.
-
Struktur:
- Logischer Aufbau, der den Leser schrittweise von grundlegenden Konzepten zu komplexeren Theorien führt.
- Klare Untergliederung in Abschnitte und/oder Unterkapitel, die verschiedene Theorien oder Konzeptbereiche behandeln.
-
Stil und Herangehensweise:
- Wissenschaftlich fundierte Argumentation.
- Neutraler, objektiver und präziser Schreibstil.
- Belegung von Aussagen durch Verweise auf die entsprechende Literatur.
Methodik
Die Methodik (oder Methodenteil) in einer Gliederung und Aufbau der Bachelorarbeit beschreibt, wie die Forschung durchgeführt wurde, um mögliche Forschungsfragen zu beantworten. Du schreibst die Methodik so als hättest du bereits alle Forschungen durchgeführt, nimmst aber keine Ergebnisse vorweg. Wichtige Elemente der Methodik sind:
- Positionierung: In der Regel folgt der Methodikteil in der Gliederung und Aufbau der Bachelorarbeit nach dem theoretischen Rahmen.
-
Forschungsdesign:
- Beschreibung des gewählten Forschungsansatzes (qualitativ, quantitativ oder gemischt).
- Erklärung, warum dieser Ansatz für die Beantwortung der Forschungsfrage geeignet ist.
-
Datenerhebung:
- Beschreibung der Methoden zur Datenerhebung (z. B. Umfragen, Interviews, Experimente, Sekundärdatenanalyse).
- Angaben zu Stichprobe, Datenerhebungszeitraum und -ort.
-
Datenanalyse:
- Darstellung der Methoden zur Datenanalyse (z. B. statistische Auswertung, Textanalyse, Softwareverwendung).
- Erläuterung, wie die Daten in Bezug auf die Forschungsfrage ausgewertet und interpretiert werden.
-
Reliabilität und Validität:
- Erklärung, wie Zuverlässigkeit und Gültigkeit der Ergebnisse sichergestellt werden.
- Ethische Überlegungen: Bei Bedarf Diskussion ethischer Aspekte der Forschung, insbesondere wenn Menschen involviert sind.
-
Limitationen:
- Hinweise auf mögliche Grenzen und Einschränkungen des gewählten methodischen Ansatzes.
Informiere dich noch zusätzlich zur Formulierung und genauen Inhalten der Methodik:
Die Ergebnisse
Die Forschungsergebnisse einer Bachelorarbeit stellen die Daten und Befunde dar, die durch die angewandte Methodik gewonnen wurden. Dieser Abschnitt ist zentral für die Arbeit und sollte folgende Aspekte beachten:
- Positionierung: Folgt direkt nach dem Methodikteil in der Gliederung und Aufbau einer Bachelorarbeit.
-
Darstellung der Ergebnisse:
-
Objektivität:
- Sachliche Darstellung der Fakten.
- Vermeidung von subjektiven Meinungen oder Interpretationen (diese gehören in den Diskussionsteil).
-
Vollständigkeit:
- Einschluss aller relevanten Ergebnisse, auch jener, die nicht die Hypothesen stützen oder von den Erwartungen abweichen.
-
Klarheit:
- Vermeidung von komplexem Fachjargon, um die Verständlichkeit zu gewährleisten.
- Ausreichende Erklärung von allen verwendeten statistischen oder analytischen Verfahren.
-
Objektivität:
-
Strukturierung:
- Logische Anordnung, oft entsprechend der Reihenfolge der Forschungsfragen oder Hypothesen.
- Falls relevant, Unterteilung nach thematischen oder methodischen Gesichtspunkten.
Die Diskussion
Die Diskussion in einer Bachelorarbeit ist entscheidend für die Interpretation der Ergebnisse und deren Einordnung in den wissenschaftlichen Kontext. Hier sind einige Schlüsselaspekte für diesen Aspekt der Gliederung und Aufbau einer Bachelorarbeit:
- Positionierung: Folgt in der Regel nach dem Ergebnisteil in der Gliederung und Aufbau der Bachelorarbeit.
-
Interpretation der Ergebnisse:
- Analyse und Erklärung der Ergebnisse: Was bedeuten sie im Kontext der Forschungsfragen oder Hypothesen?
- Vergleich der Ergebnisse mit den im theoretischen Teil dargestellten Erwartungen oder mit früheren Studien.
-
Bedeutung und Implikationen:
- Diskussion der Relevanz der Ergebnisse für das Forschungsfeld.
- Hinweise darauf, wie die Ergebnisse die bestehende Theorie, Praxis oder zukünftige Forschung beeinflussen können.
-
Kritische Reflexion und Limitationen:
- Ehrliche Bewertung der Einschränkungen der eigenen Forschung.
- Diskussion möglicher Schwächen der Methodik und wie diese die Ergebnisse beeinflussen könnten.
-
Vorschläge für zukünftige Forschung:
- Aufzeigen von Bereichen, die weiter erforscht werden sollten.
Hier findest du mehr Informationen dazu:
Das Fazit
Das Fazit deiner Bachelorarbeit ist der letzte Teil des Textteils und bildet den Schluss, in welchem du alles noch mal zusammenfasst. Es sollte thematisch zur Einleitung passen und mit ihr zusammen einen Rahmen ergeben, da es die in ihr gestellten Fragen beantworten sollte.
- Positionierung: Als abschließender Hauptteil in der Gliederung und Aufbau der Bachelorarbeit.
-
Zusammenfassung der Haupterkenntnisse:
- Kurze und prägnante Zusammenfassung der wichtigsten Forschungsergebnisse.
-
Antwort auf die Forschungsfrage:
- Direkte Bezugnahme auf die eingangs gestellte Forschungsfrage/Hypothese.
-
Schlussfolgerungen:
- Ableitungen aus den Ergebnissen und Diskussion, betont die Wichtigkeit der Arbeit.
-
Praktische Implikationen:
- Hinweise darauf, wie die Ergebnisse in der Praxis angewendet werden könnten.
-
Persönliche Reflexion:
- Abschließende Gedanken des Autors/der Autorin über das Forschungsprojekt und dessen Bedeutung.
-
Ausblick:
- Anregungen für weitere Forschung im entsprechenden Bereich.
Abschließende Bestandteile
Nach dem Textteil folgt in der Gliederung und Aufbau deiner Bachelorarbeit zunächst das Literaturverzeichnis, bevor alle anderen, teilweise optionalen Verzeichnisse folgen.
Das Literaturverzeichnis
Das Literaturverzeichnis in einer Bachelorarbeit hat folgende wichtige Anforderungen und Eigenschaften:
- Positionierung: Am Ende der Gliederung und Aufbau einer Bachelorarbeit, nach dem Fazit und eventuellen Anhängen.
-
Vollständigkeit:
- Auflistung aller Quellen, die im Text zitiert oder erwähnt werden, in alphabetischer Reihenfolge.
- Keine Aufnahme von Literatur, die nicht im Text der Arbeit erwähnt wird.
-
Einheitliche Formatierung:
- Konsequente Anwendung eines Zitierstils (z. B. APA, MLA, Harvard), der von der Hochschule oder dem Betreuer vorgegeben wird.
- Alphabetische Sortierung der Einträge nach dem Nachnamen des Erstautors.
-
Angabe der Informationen:
- Vollständige und genaue Angaben zu jedem zitierten Werk, einschließlich Autor, Titel, Veröffentlichungsjahr, Verlag, Erscheinungsort und Seitenzahlen.
-
Layout:
- Klare und übersichtliche Gestaltung, gegebenenfalls mit hängendem Einzug zur besseren Lesbarkeit.
Ergänzende Bestandteile
Nach dem Textteil und dem Literaturverzeichnis kann es sein, dass weitere Verzeichnisse in der Gliederung und Aufbau deiner Bachelorarbeit notwendig sind. Außerdem ist unter anderem ein Glossar optional einzufügen.
Anhänge
Das Anhangsverzeichnis in einer Bachelorarbeit ergänzt den Haupttext und enthält zusätzliche Informationen, die für das Verständnis der Arbeit relevant sein können, aber den Fluss des Haupttextes stören würden. Die Gestaltung und Einbindung der Anhänge sollten folgenden Kriterien entsprechen:
- Positionierung: Im Anschluss an das Literaturverzeichnis in der Gliederung und Aufbau einer Bachelorarbeit
-
Inhalt:
- Ergänzende Materialien wie Fragebögen, detaillierte Tabellen, Grafiken, technische Daten, erweiterte Beweise oder Rohdaten.
- Wichtige Informationen, die für interessierte Leserinnen und Leser von Bedeutung sind, aber nicht unmittelbar zum Haupttext gehören.
-
Übersichtlichkeit:
- Jeder Anhang beginnt auf einer neuen Seite.
- Klare Kennzeichnung und Nummerierung (z.B. Anhang A, Anhang B, etc.).
-
Verweise im Haupttext:
- Deutliche Verweise im Text der Arbeit, die den Leser auf den entsprechenden Anhang hinweisen.
Die Abbildungs- und Tabellenverzeichnisse
Das Abbildungs- und Tabellenverzeichnis in einer Bachelorarbeit dient der übersichtlichen Auflistung und leichten Auffindbarkeit aller in der Arbeit verwendeten Abbildungen und Tabellen. Hier sind die wichtigsten Anforderungen und Gestaltungshinweise:
Abbildungsverzeichnis
- Positionierung: In der Regel nach dem Inhaltsverzeichnis und vor dem eigentlichen Haupttext in der Gliederung und Aufbau einer Bachelorarbeit.
-
Inhalt:
- Auflistung aller Grafiken, Fotos, Diagramme etc.
- Jeder Eintrag enthält die Abbildungsnummer und den Titel oder eine kurze Beschreibung.
-
Formatierung:
- Konsekutive Nummerierung, üblicherweise getrennt nach einzelnen Kapiteln (z.B. Abb. 1.1, Abb. 2.1 etc.).
- Seitenangabe, auf der die jeweilige Abbildung zu finden ist.
-
Übersichtlichkeit:
- Klare und strukturierte Darstellung für einfaches Nachschlagen.
Tabellenverzeichnis
- Positionierung: Oft zusammen mit dem Abbildungsverzeichnis, entweder vor oder nach diesem in der Gliederung und Aufbau einer Bachelorarbeit.
-
Inhalt:
- Auflistung aller Tabellen der Arbeit.
- Jeder Eintrag enthält die Tabellennummer und den Titel oder eine kurze Beschreibung.
-
Formatierung:
- Ähnlich dem Abbildungsverzeichnis
- Konsekutive Nummerierung und Seitenangaben von den Seiten auf denen die Tabellen zu finden sind
-
Übersichtlichkeit:
- Einfache und konsistente Struktur, um das Nachschlagen zu vereinfachen
Das Abkürzungsverzeichnis
Das Abkürzungsverzeichnis in einer Bachelorarbeit ist eine Auflistung der in der Arbeit verwendeten Abkürzungen und deren Bedeutung. Die Gestaltung und Inhalte sollten folgende Kriterien erfüllen:
- Positionierung: In der Regel direkt nach dem Inhaltsverzeichnis, vor dem Hauptteil der Arbeit in der Gliederung und Aufbau der Bachelorarbeit.
-
Inhalt:
- Zusammenstellung aller in der Arbeit genutzten Abkürzungen und deren ausgeschriebenen Bedeutungen.
- Beinhaltet häufig Akronymen, Fachbegriffe und spezifische Kurzformen.
-
Formatierung:
- Alphabetische Ordnung der Abkürzungen zur leichteren Suche und besseren Übersicht.
- Klare Trennung zwischen Abkürzung und ihrer Definition, üblicherweise durch tabellarische Anordnung oder Spaltung in zwei Spalten.
-
Einheitlichkeit:
- Sicherstellung, dass jede in der Arbeit verwendete Abkürzung im Verzeichnis aufgeführt ist.
- Konsequente Anwendung der Abkürzungen im gesamten Text.
Das Glossar (optional)
Das Glossar in einer Bachelorarbeit dient der Erläuterung fachspezifischer Begriffe und Konzepte. Es in der Gliederung und Aufbau der Bachelorarbeit aufzunehmen, ist allerdings nicht immer verpflichtend. Hier die wichtigsten Anforderungen und Gestaltungsrichtlinien:
- Positionierung: Meist am Ende der Gliederung und Aufbau einer Bachelorarbeit, vor oder nach dem Literaturverzeichnis.
-
Inhalt:
- Definition und Erklärung wichtiger, fachspezifischer oder ungewöhnlicher Begriffe.
- Kann auch technische Termini, Fremdwörter oder spezielle Konzepte umfassen.
-
Formatierung:
- Alphabetische Anordnung der Begriffe für eine einfache Suche.
- Klarheit und Präzision in den Definitionen.
-
Umsetzung:
- Direkte, verständliche Erklärungen ohne ausschweifende Details.
- Konsistenz in Stil und Detailgrad der Begriffserklärungen.
Formale Anforderungen der Gliederung und Aufbau der Bachelorarbeit
In dieser Tabelle findest du die formalen Anforderungen an die Gliederung und Aufbau deiner Bachelorarbeit. Bitte beachte, dass diese Anforderungen je nach Universität variieren können.
| Element | Formale Anforderungen |
| Seitenlayout | Einheitliche Schriftart (z.B. Arial), Schriftgröße (z.B. 12 pt), Zeilenabstand (1,5 Zeilen), einheitliche Ränder |
| Zitierweise | Festgelegter Zitierstil (z.B. APA, Harvard), einheitlich im gesamten Text |
| Abbildungen und Tabellen | Klare Beschriftung, Nummerierung, Verweis im Text |
| Literaturverzeichnis | Alphabetische Ordnung, vollständige Angaben gemäß gewähltem Zitierstil |
| Sprache | Akademischer Stil, Korrekturlesen auf Grammatik und Rechtschreibung, Vermeidung von Umgangssprache |
Beispiel Gliederung und Aufbau einer Bachelorarbeit
Im Folgenden findest du für jeden Abschnitt der Gliederung und Aufbau einer Bachelorarbeit ein konkretes Beispiel, das dir als Orientierung für den Aufbau und die Formulierung deiner eigenen Arbeit dienen kann.
Hinweis: Die Beispiele sollen dir als Formulierungshilfe und Strukturvorlage dienen. Achte bei deiner eigenen Arbeit darauf, das Thema sowie die spezifischen Anforderungen deines Studiengangs zu berücksichtigen.
Häufig gestellte Fragen
Jeder perfekte Aufbau und Gliederung einer Bachelorarbeit ist ähnlich strukturiert:
- Vorlaufseiten (Deckblatt, Danksagung, eidesstattliche Versicherung, Abstract, Inhaltsverzeichnis)
- Textteil (Einleitung, theoretischer Rahmen, Methodik, Ergebnisse, Diskussion, Fazit)
- Verzeichnisse (Literaturverzeichnis, Anhänge, Abbildungs- und Tabellenverzeichnis, Abkürzungsverzeichnis, Glossar)
Manche dieser Bestandteile sind in der Gliederung und Aufbau einer Bachelorarbeit allerdings optional.
Im Textteil der Gliederung und Aufbau der Bachelorarbeit beantwortest du die Forschungsfrage, also das Thema der Bachelorarbeit. Du beginnst mit einer Einleitung, die Informationen zum Thema gibt oder ein Problem erklärt. Danach im Hauptteil erklärst du mit Literatur den Forschungsstand des Themas. In der Methodik erläuterst du, wie du deine Forschungen anstellen möchtest, diese Ergebnisse stellst du dann vor, diskutierst sie und schreibst ein Fazit, dass noch mal alles zusammenfasst.
Die perfekte Gliederung und Aufbau deiner Bachelorarbeit lässt sich ganz einfach als Inhaltsverzeichnis in Word erstellen. Word erkennt die markierten Überschriften deiner Arbeit und erstellt dir daraus automatisch eine Gliederung.
Meistens ist das Inhaltsverzeichnis nicht Teil der Seitennummerierung. Wenn du dein Inhaltsverzeichnis bei Word erstellst, kannst du das auch ganz einfach entsprechend einstellen. Die Seitennummerierung beginnt dann erst bei der Einleitung. Denk daran, dass die Einleitung aber nicht die Seite 1 ist, sondern etwa die Seite 3, auch wenn die vorherigen Seiten keine sichtbare Nummerierung haben.
Du verwendest in deinem Inhaltsverzeichnis dieselbe Schriftart, wie in der gesamten Bachelorarbeit. Das wäre Times New Roman, Arial oder Calibri. Wenn du das Inhaltsverzeichnis in Word erstellst, kannst du die Hauptgliederungspunkte fetten, die Schriftgröße sollte jedoch gleich bleiben (meist 12 pt.)