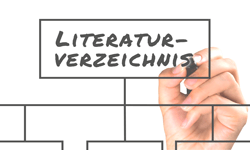
Ein vollständiges Literaturverzeichnis ist essenziell für Aufbau und Gliederung jeder wissenschaftlichen Arbeit. Es ist dabei wichtiger Bestandteil im Umgang mit den zitierten Quellen innerhalb deiner Arbeit. Dabei ist es zweitrangig, welchen Zitierstil du nutzt, ein ordentliches Literaturverzeichnis benötigst du immer. Wie du es anlegst, was dabei zu beachten ist und welche Relevanz es hat, erfährst du in diesem Beitrag.
Definition: Literaturverzeichnis
Das Literaturverzeichnis steht am Ende der wissenschaftlichen Arbeit vor der Selbstständigkeitserklärung und enthält alle Quellen, die in der Arbeit zitiert wurden. Es dient vor allem der Transparenz der zitierten Quellen und garantiert, dass sie auffindbar und nachprüfbar sind. Jeder einzelne Eintrag muss alle nötigen Informationen enthalten, die benötigt werden, um eine Quelle zurückzuverfolgen.
Auch wenn unterschiedliche Zitierstile verschiedene Anforderungen bezüglich der formalen Gestaltung der Einträge haben: Im Kern sind es die gleichen Elemente, nur anders angeordnet. So sieht der Eintrag in seiner Grundstruktur aus:
Name, Vorname: Titel/Untertitel, (Auflage) Ort, Jahr.
Dieser wird durch zusätzliche Informationen erweitert, um der Veröffentlichungsart der Quellen Rechnung zu tragen. Die Einträge werden alphabetisch nach den Nachnamen der Autoren geordnet.
Beachte: Bei der Erstellung ist wesentlich, dass alle Einträge einem konkreten Zitierstil folgen und auch die Zeichensetzung einheitlich verwendet wird.
Unterschied zum Quellenverzeichnis
Es gibt häufig Verständigungsprobleme darüber, was ein Literaturverzeichnis überhaupt ist, weil der Begriff sowie Bibliografie, Quellenverzeichnis etc. häufig als Synonyme verwendet werden. Für ein Literaturverzeichnis musst du jedoch alle Quellen im Verzeichnis angeben, die in deiner Arbeit zitiert wurden. Wenn du ein Buch nur mal gelesen hast, es aber nicht in deiner Arbeit zitiert wurde, erfolgt für diese Quelle keine Angabe im Verzeichnis. Im Gegensatz dazu listet ein Quellenverzeichnis listet auf, die für die Erstellung der Arbeit herangezogen wurden, unabhängig davon, ob sie direkt zitiert werden oder nicht. Das schließt Primär- und Sekundärquellen mit ein, die für das Verständnis des Themas relevant sind, aber nicht direkt zitiert wurden.
Merke: Der Begriff „Bibliografie“ wird für ein Verzeichnis verwendet, welches einen Überblick über Literatur zu einem Themenkomplex bietet, also nicht nur auf zitierte Literatur im Text beschränkt ist. Bei wissenschaftlichen Arbeiten ist aber gefordert, die tatsächlich zitierte Literatur anzugeben, daher sollte der Begriff Bibliografie nicht verwendet werden.
Bedeutung
Das Literaturverzeichnis deiner wissenschaftlichen Arbeit ist aus mehreren Gründen von großer Bedeutung:
- Nachweis der Quellenbasis: Das Verzeichnis dokumentiert die Quellen, die der Autor für die Forschung und Argumentation verwendet hat. Es zeigt, dass die Arbeit auf einer fundierten Grundlage basiert.
- Vermeidung von Plagiaten: Durch die ordnungsgemäße Referenzierung der Quellen lassen sich Plagiate verhindern. Indem man die Quellen korrekt angibt, gibt man anderen Autoren den Kredit für ihre Arbeit.
- Wissenschaftliche Integrität: Ein korrektes Verzeichnis ist ein Zeichen für wissenschaftliche Integrität. Es zeigt, dass der Autor ehrlich und verantwortungsbewusst mit den Quellen umgeht.
- Überprüfbarkeit und Reproduzierbarkeit: Die genaue Angabe der Quellen ermöglicht es anderen Forschern, die Arbeit zu überprüfen und die Ergebnisse zu reproduzieren.
Struktur
Nichts kommt ohne die richtige Formatierung aus; neben der Einheitlichkeit des Stils der aufgeführten Werke, gibt es noch andere rein formale Aspekte, die man beim Erstellen beachten sollte. Im Folgenden befinden sich einige Hinweise zur Anordnung der einzelnen Angaben:
| Reihenfolge der Werke |
| Alle Quellen werden nach dem Nachnamen ihres Autors in alphabetischer Reihenfolge im Verzeichnis aufgelistet. Bei mehreren Autoren zu einer Quelle wird der erstgenannte Autor zur Einsortierung verwendet. |
| Mehrere Autoren |
| Hat ein Werk mehrere Autoren, können diese durch ein Semikolon getrennt aufgelistet werden. Im Verzeichnis müssen alle Autoren genannt werden. |
| Mehrere Erscheinungsorte |
| Es werden bis zu drei Erscheinungsorte genannt, getrennt durch Gedankenstriche, Kommas oder Semikolons. Bei mehr als drei Orten folgt hier die Abkürzung "et al." nach dem ersten Erscheinungsort. |
Zitierstile
Die Form der Quellenangabe und somit die Anordnung der Bestandteile wird durch deinen gewählten Zitierstil festgelegt. Die meistverbreiteten Zitierstile sind:
Harvard-Zitierweise
APA zitieren
Deutsche Zitierweise
Literaturverzeichnis erstellen
Du kannst einige Hilfsmittel nutzen, um dir den Umgang mit dem Literaturverzeichnis zu erleichtern. Damit kannst du alle notwendigen Informationen für eine vollständige Quellenangabe strukturieren und somit falsche Quellenangaben vermeiden.
Erstellung in Word
Die Erstellung in Microsoft Word ist ein einfacher Prozess, der eine präzise Formatierung ermöglicht. Zunächst sollten die verwendeten Quellen sorgfältig notiert werden, einschließlich Autor, Titel, Verlag und Erscheinungsjahr. Anschließend wählt man in Word die Registerkarte „Verweise“ und klickt auf „Literaturverzeichnis“.
Hier kann man zwischen verschiedenen Zitierstilen wählen. Nach der Auswahl wird das Verzeichnis automatisch generiert, und bei Bedarf können neue Quellen hinzugefügt oder bearbeitet werden. Durch diesen Schritt spart man Zeit und gewährleistet eine korrekte und professionelle Zitierung.
Word Vorlage
Alternativ kannst du auch diese Word-Vorlage nutzen, um dein Literaturverzeichnis zu erstellen. In dieser Vorlage wird nach der deutschen Zitierweise zitiert.
Tools zur Literaturverwaltung
Literaturverwaltungsprogramme sind nützliche Werkzeuge, die Forscher und Schriftsteller dabei unterstützen, ihre Quellen und Literatur effizient zu organisieren und zu verwalten.
Nachfolgend eine Übersicht über drei bekannte Tools:
Citavi ist ein kommerzielles Literaturverwaltungsprogramm, das von der Swiss Academic Software GmbH entwickelt wird. Es ist für Windows verfügbar und bietet verschiedene Editionen für Studierende, Wissenschaftler und Institutionen.
Vorteile:
- Umfangreiche Funktionalität: Citavi bietet umfangreiche Möglichkeiten zur Literaturverwaltung, Quellensuche, Aufgabenplanung und Wissensorganisation.
- Integrierte Literaturrecherche: Citavi ermöglicht eine direkte Suche nach Literatur in Bibliothekskatalogen und Datenbanken.
- Automatisierte Zitate und Verzeichnisse: Das Programm unterstützt eine Vielzahl von Zitierstilen und ermöglicht automatisierte Zitate im Text sowie die Erstellung von Verzeichnissen mit deiner Literatur.
- Teamarbeit: Citavi erlaubt die Zusammenarbeit in Teams, um Literaturdatenbanken gemeinsam zu nutzen und an gemeinsamen Projekten zu arbeiten.
- Wissensorganisation: Es ermöglicht die Strukturierung und Verknüpfung von Notizen, Gedanken und Zitaten, um die Wissensorganisation zu erleichtern.
- Cloud-Synchronisation: Mit einer kostenpflichtigen Lizenz kann man die Literaturdatenbank über verschiedene Geräte hinweg synchronisieren.
Zotero ist kostenlos und für Windows, macOS und Linux verfügbar. Es ist eine Erweiterung für den Webbrowser, die es ermöglicht, Literaturquellen direkt aus dem Web zu importieren.
Vorteile:
- Kostenfrei und Open Source: Zotero ist kostenlos und eine Open-Source-Software, was es für viele Nutzer attraktiv macht.
- Browser-Integration: Zotero ermöglicht das einfache Erfassen von Literaturquellen und anderen Quellenarten direkt aus dem Webbrowser.
- Vielfältige Exportmöglichkeiten: Es bietet verschiedene Exportoptionen für Verzeichnisse und ermöglicht den Export in verschiedene Formate wie BibTeX, RIS, Word usw.
- Gruppenfunktionen: Zotero ermöglicht die gemeinsame Nutzung von Literaturdatenbanken und die Zusammenarbeit in Forschungsteams.
- Plugin-Unterstützung: Es gibt eine breite Palette von Plugins, die die Funktionalität und Möglichkeiten von Zotero erweitern.
JabRef ist ebenfalls kostenlos und quelloffen. Es ist plattformunabhängig und kann auf Windows, macOS und Linux verwendet werden.
Vorteile:
- BibTeX-Fokus: JabRef ist spezialisiert auf das BibTeX-Format, das vor allem in der LaTeX-Textverarbeitung häufig verwendet wird.
- Such- und Filterfunktionen: Es bietet umfangreiche Such- und Filtermöglichkeiten, um die Literaturdatenbank effizient zu durchsuchen.
- Anpassbare Einstellungen: JabRef erlaubt die Anpassung der Felder und Eingabemasken, um den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden.
- Integration in LaTeX: Es ermöglicht die Integration mit LaTeX-Editoren, um Zitate und Verzeichnisse in LaTeX-Dokumenten zu verwalten.
Häufig gestellte Fragen
Um ein perfektes Literaturverzeichnis zu erstellen, sammle alle verwendeten Quellen mit Autor, Titel, Verlag und Erscheinungsjahr. Verwende dann in Microsoft Word die Registerkarte „Verweise“ und wähle „Literaturverzeichnis“ aus, um automatisch ein korrekt formatiertes Verzeichnis zu generieren.
Im Literaturverzeichnis stehen alle Quellen, die du verwendet hast. Dabei ist es egal, ob es sich um eine Quelle aus einem Buch, Sammelband oder einer Internetseite handelt. Ein Eintrag im Literaturverzeichnis sieht in den meisten Fällen wie folgt aus:
Name, Vorname: Titel/Untertitel, (Auflage) Ort, Jahr
Ein Literaturverzeichnis benötigst du, wenn du eine wissenschaftliche Arbeit verfasst und dafür andere Werke als Quellen verwendest. Dies ist bei wissenschaftlichen Arbeiten immer der Fall, auch wenn sich deine Arbeit hauptsächlich um deine eigene Forschung dreht. Selbst wenn du nur deine eigenen Forschungsergebnisse präsentierst, solltest du den aktuellen Stand der Wissenschaft erläutern und dafür brauchst du Literatur von anderen Autoren.
Literatur- und Quellenverzeichnis werden umgangssprachlich gerne als Synonyme verwendet, das ist allerdings bei der Anwendung in einer wissenschaftlichen Arbeit nicht korrekt. Im Literaturverzeichnis wird das verwendete Werk mit seinem Autor, Erscheinungsjahr und Verlag genannt. Beim Quellenverzeichnis kommt zusätzlich noch die Seitenangabe hinzu, auf der die verwendete Information zu finden ist.
Bei wissenschaftlichen Arbeiten ist es entscheidend, dass du kennzeichnest, was nicht deiner eigenen Geistesleistung entsprungen ist. Sprich, alle Ideen und Forschungsergebnisse, die du während deiner Recherche gefunden hast und in deiner Arbeit verwendest, musst du auch entsprechend kennzeichnen.